Zwischen Denken und Wahrnehmen
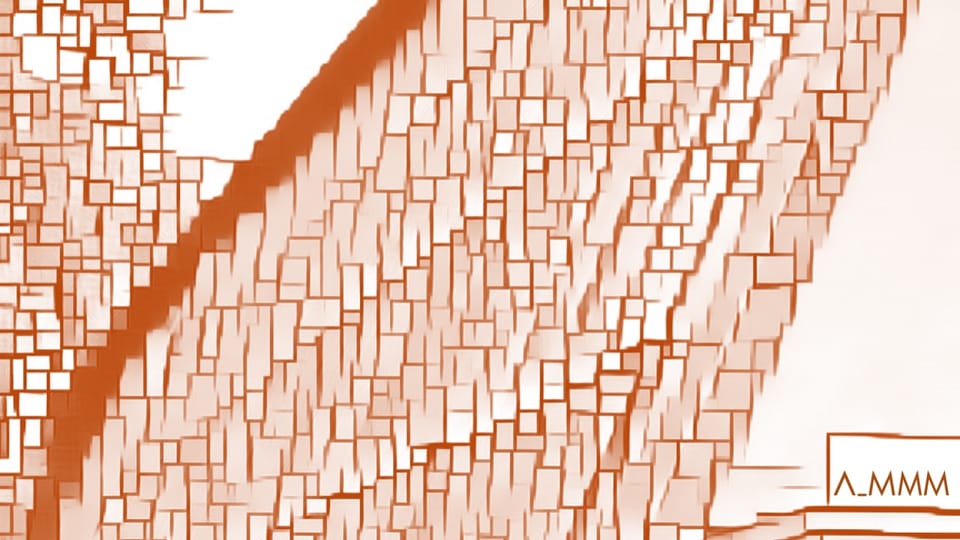
Über transkonzeptuelle Achtsamkeit – und was sie im mediationsförmigen Raum bewirken kann
Transkonzeptuelle Achtsamkeit – ein Begriff, der ein Wahrnehmen beschreibt, das nicht über etwas, sondern mit etwas erkennt. Mich interessiert hier, was dieser Gedanke im mediationsförmigen Raum sichtbar macht: jene feine Bewegung zwischen Denken und Wahrnehmen, in der Beziehung zu Bewusstsein wird.
Manchmal geschieht es mitten im Gespräch. Ein Wort verhallt, eine Hand bewegt sich, ein Atemzug bleibt aus. Und plötzlich spürt man – etwas hat sich verändert. Nichts Sichtbares, nichts Benennbares. Eher ein inneres Aufleuchten, als würde der Raum kurz zu sich selbst kommen.
Solche Momente kennen wir alle, die wir mit Menschen in Prozessen arbeiten. Wir nennen sie Intuition, Präsenz oder schlicht Aufmerksamkeit. Doch vielleicht ist es mehr als das – vielleicht eine Form von Wissen, die jenseits der Begriffe liegt. Ein Wahrnehmen, das nicht über etwas, sondern mit etwas erkennt.
Die Stille zwischen zwei Gedanken
Im Kern beschreibt dieser Gedanke eine Qualität des Gewahrseins, die sich auf jener Schwelle ereignet, an der Wahrnehmung noch nicht zu Sprache geworden ist. Man könnte sagen: ein Sehen vor dem Benennen. Wir merken, dass unser Denken bereits Form annimmt – und bleiben für einen Augenblick still genug, um diese Form zu spüren.
In der Mediation kann dieser Moment kostbar sein. Denn er verschiebt das Verhältnis von Wissen und Nicht-Wissen: Statt zu erklären, beginnen wir zu hören – wirklich zu hören. Nicht nur den Worten, sondern auch dem, was zwischen ihnen geschieht.
Achtsamkeit in diesem Sinn ist kein Zustand, sondern eine Bewegung. Sie entsteht dort, wo der Mediator oder die Mediatorin bemerkt, wie das eigene Verstehen entsteht – eine kleine Selbsttransparenz. Ein Bewusstsein dafür, dass Wahrnehmung selbst Beziehung ist.
Vom Selbst zur Situation
Im Ad_Monter Meta Modell (A_MMM) lässt sich diese Bewegung als Resonanz zwischen Selbstklärung (c-me) und Begegnung (c-us) lesen. Aber – und das ist entscheidend – diese beiden Felder sind keine Rollenräume (Ich ↔ Du), sondern Wahrnehmungsmodi. Man kann sich selbst im Verhältnis zu einer Person klären – oder zu einem Prozess, zu einer Organisation, zu einem Gedanken.
Achtsamkeit meint hier also die Fähigkeit, sich in Beziehung zu etwas zu erleben – gleichgültig, ob dieses Etwas menschlich, strukturell oder symbolisch ist.
Das A_MMM versteht diese Struktur fraktal: Was im Kleinen geschieht – etwa im Atem des Mediators – wiederholt sich im Großen, im Verlauf des gesamten Verfahrens. In jedem Moment, in dem Resonanz entsteht, bildet sich dieselbe Figur: Selbstklärung, Begegnung, Gestalten. Achtsamkeit ist die innere Bewegung, die diese Figur lebendig hält.
Dienstleistende Präsenz
Man könnte sagen: Der Mediator ist dienstleistend anwesend. Ein schönes, stilles Wort.
Es meint eine Professionalität, die nicht auf Anwendung, sondern auf Wahrnehmung beruht. Der Mediator stellt seine Aufmerksamkeit zur Verfügung – nicht als Technik, sondern als Resonanzraum.
Das bedeutet: Er hält aus, was sich zeigt, ohne es sofort zu deuten. Er vertraut darauf, dass das System selbst etwas weiß, das noch nicht gesagt ist. Seine Legitimität entsteht nicht aus Autorität, sondern aus Wahrnehmungsqualität.
Diese Haltung ist anspruchsvoll, weil sie eine paradoxe Position verlangt: Teil des Systems sein – und doch einen inneren Schritt zurückbleiben. Handeln – und zugleich Raum halten.
Das erfordert jene Art von Achtsamkeit, die nicht gezähmt, sondern geerdet ist – wachsame Ruhe im Strom des Geschehens.
Non-duales Wissen
In vielen Achtsamkeitsdiskursen bleibt die alte Trennung bestehen: Ich beobachte – du wirst beobachtet.
Transkonzeptuelle Achtsamkeit löst diese Grenze auf, ohne sie zu verwischen. Sie erkennt, dass Wahrnehmung selbst Beziehung ist. Dass jedes Sehen schon Teil des Gesehenen ist.
Im mediationsförmigen Kontext bedeutet das: Der Konflikt ist nicht da draußen – er entsteht im Raum zwischen den Beteiligten, im Feld ihrer Aufmerksamkeit. Und der Mediator ist kein neutraler Dritter, sondern ein temporärer Resonanzkörper, durch den das System sich selbst erkennt.
Das erfordert eine Ethik der Wahrnehmung: Klarheit ohne Urteil, Mitgefühl ohne Verschmelzung.
Achtsamkeit als Wandel
Vielleicht liegt genau hier der Wandel, den Mediation in einer Zeit zunehmender Komplexität anbieten kann: Sie ersetzt Kontrolle durch Beziehung, Analyse durch Resonanz.
Und sie erinnert daran, dass Verständigung nicht nur ein Ziel ist, sondern ein Zustand des gemeinsamen Gewahrseins.
Achtsamkeit wird so zum Medium, in dem Legitimität überhaupt erst erfahrbar wird – weil sie uns erlaubt, inmitten von Unterschiedlichkeit gegenwärtig zu bleiben.
Man könnte sagen: Sie ist eine Epistemologie der Nähe.
Resonanzfragen
– Wann hast du in deiner Arbeit gespürt, dass Stille mehr bewegt als Argumente? – Wie verändert sich dein Wahrnehmen, wenn du nicht auf die Parteien, sondern auf den Prozess als Ganzes hörst? – Was heißt es für dich persönlich, dienstleistend anwesend zu sein?
Conclusio
Achtsamkeit erkennt, indem sie berührt. Sie sieht, indem sie mitschwingt. Und manchmal genügt ein Atemzug, damit das Gespräch wieder zu sich selbst findet.
Der Begriff „transkonzeptuelle Achtsamkeit“ wurde von Wolfgang Paul Reutter wissenschaftlich vertieft und phänomenologisch-systemisch entfaltet (Nomos 2017).
