Im Augenblick – die Wahrheit des Unverfügbaren
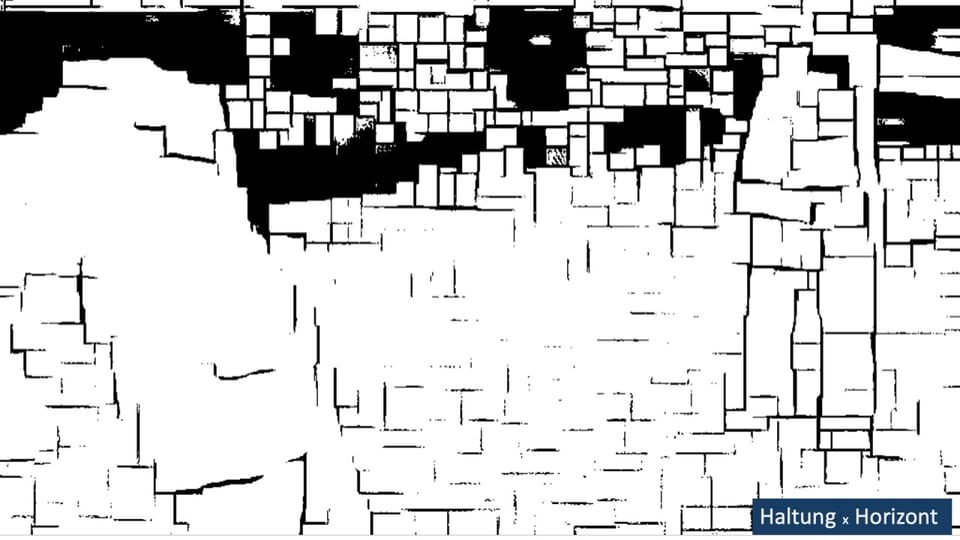
Warum das Wesentliche nicht reproduzierbar ist – und gerade dadurch Zukunft schenkt.
Der Saal im Linzer Posthof ist voll an diesem Abend. Lars Eidinger tritt auf die Bühne, begleitet von Hans-Jörn Brandenburg am Klavier. Gemeinsam lassen sie Brechts Hauspostille erklingen – ein Werk, das schon in seiner Anlage zwischen Liturgie und Revolte schwankt. Doch es ist nicht Brecht allein, der diesen Abend trägt. Es ist Eidingers Art, immer wieder den Kontakt ins Publikum zu suchen, die Grenze zwischen Darstellendem und Betrachtendem aufzulösen, das Theater als lebendiges Geflecht von Blicken, Stimmen und Atemzügen sichtbar zu machen.
In einer dieser Interaktionen spricht er von der Besonderheit des Theaters. Nicht das Memorierte, nicht das Aufgezeichnete mache seine Wahrheit aus. Sondern das, was jedes Mal neu entstehe – durch die Anwesenheit, durch das Unerwartete, durch das unberechenbare Echo aus dem Publikum. Zur Bekräftigung zitiert er eine englische Autorin, die nur wenige Werke hinterließ und jung starb: Sarah Kane, 1971 geboren, 1999 gestorben, im Alter von nur 27 Jahren. Sie schrieb:
“Theatre has no memory, which makes it the most existential of the arts.”
Ein Satz wie eine Schneise. Theater hat kein Gedächtnis – nicht im Sinne von Vergessen, sondern im Sinne von Nicht-Reproduzierbarkeit. Keine Aufführung ist wiederholbar, keine Szene konservierbar, kein Abend derselbe wie ein anderer. Was geschieht, geschieht einmal. Und verschwindet in dem Moment, in dem es wirklich wird.
Unverfügbarkeit
In einer Welt, die alles aufzeichnen, speichern und wiederholbar machen will, erinnert uns dieser Satz an eine andere Wahrheit: Das Wesentliche bleibt unverfügbar. Wir können Technik anwenden, Räume bauen, Texte vorbereiten – doch ob sich im entscheidenden Augenblick etwas öffnet, bleibt jenseits unseres Zugriffs.
Unverfügbarkeit ist kein Mangel. Sie ist die stille Signatur des Lebendigen.
Sie verweist uns auf eine Haltung: nicht alles zu beherrschen, sondern bereit zu sein, berührt zu werden.
Begegnung ist nicht „machbar“, sondern geschieht, wenn wir uns öffnen – und bereit sind, sie zu empfangen.
Die Trias des Lebendigen
Drei Dimensionen prägen dieses Erleben: Kontingenz, Resonanz und Vulnerabilität.
- Kontingenz – es könnte auch anders sein. Begegnung ist offen, nicht festgelegt, nicht abgesichert. Das birgt Unsicherheit – und schenkt Freiheit.
- Resonanz – etwas antwortet. Ein Wort, ein Blick, ein Schweigen ruft Echo hervor. Resonanz verwandelt Austausch in Begegnung.
- Vulnerabilität – die Bereitschaft, sich zu zeigen. Ohne Risiko kein Verstehen. Nur wer verletzlich ist, kann Resonanz empfangen.
Diese Trias ist keine Theorie. Sie beschreibt eine Erfahrung, die wir alle kennen – im Theater, in Gesprächen, in Augenblicken, in denen wir spüren: Hier geschieht etwas, das nicht verfügbar ist, aber wahr.
Gegenwart als Kunstform
Theater, sagt Kane, hat kein Gedächtnis.
Vielleicht müsste man genauer sagen: Es hat keine Erinnerung im Sinn von Wiederholbarkeit.
Was bleibt, ist nur das Erlebte – in den Menschen, die dabei waren, nie jedoch als Kopie.
Man könnte ergänzen: Alles, was uns verwandelt, hat kein Gedächtnis im Sinne von Reproduktion. Musik im Konzert, ein Blick im Gespräch, ein Moment, in dem Stille Gewicht bekommt – nichts davon lässt sich festhalten. Und gerade dadurch trägt es Bedeutung.
Wir leben in einer Kultur der Aufzeichnung. Alles wird archiviert, alles ist jederzeit abrufbar.
Und doch gilt: Das Entscheidende entzieht sich. Nicht, weil es schwach wäre, sondern weil es uns nicht gehört.
Vielleicht liegt darin die Wohltat: dass wir uns auf Augenblicke verlassen können, die wir nicht besitzen. Dass wir Vertrauen lernen in etwas, das sich nicht wiederholen lässt.
Spuren statt Kopien
Unverfügbarkeit bedeutet nicht Leere. Sie hinterlässt Spuren – nicht als Kopie, sondern als Resonanz:
- in veränderten Blicken,
- in einer gelösten Anspannung,
- in einem Satz, der hängenbleibt.
So schenkt sie Zukunft.
Nicht, weil wir sie geplant haben, sondern weil uns etwas geschah, das sich nicht festhalten ließ.
Wir haben die Wahl:
Wollen wir alles der Logik der Reproduktion unterwerfen – oder wagen wir, der Spur des Unverfügbaren zu vertrauen?
Im ersten Fall gewinnen wir Sicherheiten.
Im zweiten Fall gewinnen wir Verwandlung.
Zwischen Kontrolle und Vertrauen
Vielleicht ist das die Haltung, die uns heute fehlt: Vertrauen darauf, dass nicht alles verfügbar sein muss. Nicht jede Begegnung planbar, nicht jede Erfahrung aufzeichnbar, nicht jeder Moment wiederholbar.
Unverfügbarkeit bedeutet: nicht ich verfüge – sondern ich werde berührt.
Und indem ich berührt werde, kann ich anders handeln.
Was wir brauchen, ist eine soziale Grammatik: eine feine Ordnung des Zuhörens und Antwortens, die nichts erzwingt und doch trägt. Sie gibt Resonanz Rhythmus, ohne sie zu fixieren – und erlaubt uns, im Offenen standzuhalten.
Ein Resonanzmodell für die Gesellschaft
Wie können wir mit Unverfügbarkeit leben – nicht nur im Theater, sondern gesellschaftlich?
Die Denkfigur der Admonter Raute im Ad_Monter Meta Modell erinnert daran, dass jeder Versuch, Unverfügbarkeit zu leugnen, in Erstarrung endet.
- Wer beim Klären im Eigenen steckenbleibt, verliert das Offene.
- Wer beim Selbst unreflektiert verharrt, verliert das Gegenüber.
- Wer im Zwischen das Gemeinsame scheut, verliert die Gestalt.
- Wer zu schnell gestaltet, verliert Tiefe und Weite.
Die Raute zeigt keinen Weg der Kontrolle, sondern eine Bewegung der Balance.
Sie lädt ein, mit der Unverfügbarkeit zu tanzen, statt sie bannen zu wollen.
Die drei Wege – Verstehen, Begegnen, Gestalten – sind in diesem Sinn auch gesellschaftliche Haltungen:
- Verstehen heißt, Vielstimmigkeit auszuhalten.
- Begegnen heißt, Resonanz und Verletzlichkeit auch im Politischen zuzulassen.
- Gestalten heißt, aus Augenblicken Spuren zu formen, die tragen – ohne sie zu verabsolutieren.
Das Modell entfaltet keinen Bauplan, sondern einen Resonanzraum für Verantwortung:
eine Sprache, die Unverfügbarkeit nicht verdrängt, sondern fruchtbar macht.
Epilog – Sehen, was noch nicht ist
Unverfügbarkeit anerkennen heißt: den Blick nicht nur auf das richten, was ist, sondern auf das, was möglich werden könnte.
Wenn wir dem Augenblick Raum geben, öffnen sich Schwellen, die uns über das Gegebene hinausweisen.
Jagoda Marinić hat dies in ihrer Eröffnungsrede zum Internationalen Brucknerfest Linz eindrucksvoll formuliert:
Wir verlieren uns leicht im Dunkel der Krisen – und doch liegt unsere Aufgabe im Sehen dessen, was noch nicht ist.
Was auf einer Bühne geschieht, ist auch in gesellschaftlichen Räumen notwendig:
ein Wagnis der Gegenwart, das Spuren hinterlässt.
Keine Kopien. Keine Wiederholungen.
Sondern Verwandlungen, die uns erlauben, gemeinsam weiterzugehen.
Unverfügbarkeit anerkennen heißt: Schwellen nicht zu fürchten, sondern sie als Übergänge zu begreifen.
So wie Theater und Musik uns erinnern, dass Resonanz nicht reproduzierbar ist –
und gerade dadurch Zukunft schenkt.
Wer nach Bildern sucht, die solche Bewegungen sichtbar machen, findet sie im Ad_Monter Meta Modell.
